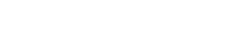"Das Hospiz war der Schrittmacher"
Die Ärztin Mechthild Bürger und der Arzt Günther Bürger haben sich
seit 2004 in der Palliativmedizin fortbilden lassen. Das Ehepaar
betreibt eine Praxis in Wiehl und ist regelmäßig im Johannes-Hospiz
Oberberg in Wiehl im Dienst. Im Interview sprechen die beiden über das
Umdenken beim Versorgen sterbender Menschen, über die Angst vor dem
Sterben und die Inhalte der Palliativmedizin.

Sie gehörten zu den ersten Palliativärzten im Oberbergischen Kreis. Mittlerweile haben ein Drittel der Mediziner im Kreisgebiet diese Zusatzausbildung durchlaufen. Woher kommt dieses Interesse an einer qualifizierteren Versorgung sterbender Menschen?
Mechthild Bürger: In meinen frühen Berufsjahren habe ich in den Kliniken oft miterlebt, dass die Medizin alles daran setzt, dass Menschen überleben und geheilt werden. Konnte das nicht erreicht werden, machte sich der Gedanke breit, angesichts des Todes versagt zu haben. Es war dann auch die Hospizbewegung, die für ein Umdenken sorgte. Denn sie machte deutlich, dass ein medizinisches und ganzheitliches Betreuen sterbender Menschen ebenso wichtig ist wie eine heilende Therapie für Genesende.
Die Hospizidee verbreitete sich im Oberbergischen Kreis vor etwa 20 Jahren. In dieser Zeit habe ich meine Ausbildung zur Hospizhelferin bei den Maltesern in Wiehl gemacht. Die ambulante Unterstützung setzte den Anfang eines Umdenkens im Oberbergischen Kreis, das Hospiz in Wiehl ist dann mit seiner Eröffnung im Jahr 2005 der Schrittmacher für eine verbesserte palliative Versorgung gewesen.
Günther Bürger: Auch die
zunehmenden Krebs-Erkrankungen erforderten ein Umdenken. Ein Tumor ist
Schicksal und damit kein Grund für den behandelnden Arzt, sich als
Versager zu fühlen. Bis zum Aufkommen der Hospizbewegung fühlten sich
Mediziner oft hilflos angesichts sterbender Patienten. Doch mit der
Palliativmedizin stehen Ärzte dem Sterben nicht mehr ohnmächtig
gegenüber. Viel mehr können sie mit ihr helfen, das Leiden unheilbar
erkrankter Menschen zu lindern.
Was lernt man bei der Fortbildung in der Palliativmedizin?
Günther Bürger: Ein generelles Ziel dieser Weiterbildungsangebote ist, sich in einer geschützten Atmosphäre mit den Themen Sterben, Tod und Trauer auseinanderzusetzen und die fachliche Kompetenz im jeweiligen beruflichen Feld zu erweitern. Inhalt der Lehreinheiten ist zum einen die Symptomkontrolle. Wir lernten, wie man den Menschen die Begleiterscheinungen einer tödlichen Erkrankung lindern kann.
Die
Fortschritte in der Pharmakotherapie und bessere Kenntnis des
individuellen Einsatzes von Medikamenten sind wichtige Beiträge zur
Linderung von Schmerzen, Luftnot, Übelkeit und Ängsten. Naturheilkunde
und pflegerische Maßnahmen am Lebensende sind ebenso Themen der
Weiterbildung wie eine verbesserte Kommunikation auf Augenhöhe mit den
Patienten. Denn in der Hospizarbeit stehen der Wille und die Bedürfnisse
des sterbenden Menschen im Mittelpunkt.
Jetzt werden immer mehr sterbende Menschen ganzheitlich betreut. Und schon gibt es Kritik an den Kosten ...
Mechthild Bürger: Die Idee einer optimierten Gesellschaft, in der Nutzen und Gewinn im Mittelpunkt stehen, ist auch in unserem beruflichen und privaten Umfeld immer wieder Thema. Unter dem hinlänglich bekannten Kostendruck entsteht naturgemäß auch eine Diskussion darüber, wie lange sich unsere Gesellschaft diese erwünschte Palliativmedizin auf hohem Niveau wird leisten können. Doch eine unzureichende Palliativmedizin, die den Menschen das Leiden nicht lindern kann, liefert wiederum Argumente für die Befürworter der aktiven Sterbehilfe.
Allerdings treten meist die Menschen für die aktive Sterbehilfe ein, die selbst noch nicht mit ihrem eigenen Sterben konfrontiert sind. Für einen unheilbar erkrankten Menschen wird nämlich jeder einzelne Tag, den er noch erleben kann, wichtig. Das erlebe ich jedenfalls immer wieder bei meinem Dienst im Johannes-Hospiz.
Hat man als Palliativmediziner noch Angst vor dem Sterben?
Günther Bürger: Ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie ich mit meinem eigenen Sterben umgehen werde. Art und Ort meines Sterbens kann ich jetzt noch nicht absehen. Als Palliativmediziner lernt man jedoch, die eigenen Ängste besser zu verstehen und zu kontrollieren. Man lernt, angemessen mit den Patienten über das Sterben zu sprechen. Denn wir Ärzte sollten in dieser Hinsicht ehrlich und offen sein - ohne unhöflich und unbarmherzig zu klingen.
Können Sie den Patientinnen und Patienten die Angst nehmen?
Mechthild Bürger: Am Lebensende stehen nicht selten die Verzweiflung, Angst, Familientragödien und Sprachlosigkeit. Es gibt eben kein „Schöner Sterben". Bei aller medizinischen, spirituellen und pflegerischen Fürsorge können wir daher tragische Momente nicht immer auflösen, wir können ihnen aber die Schärfe nehmen. Und immer wieder erleben wir, dass bei einer ganzheitlichen palliativen Betreuung der Wunsch nach Sterbehilfe schwindet und der natürliche Sterbeprozess angenommen wird.
Text und Foto: Sabine Eisenhauer
27.07.2016 - Wiehl